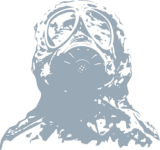Infos zur Prozession (klick mich an)
Wem der Text hier drunter zu lang werden sollte, der bekommt hier die knackigen Infos direkt:
- Die Feierlichkeiten der Prozession wurden schriftlich erstmalig im Jahr 1475 dokumentiert
- Es gibt Hinweise darauf, dass der Brauch der “Beerdigung Christi” in Lessines noch viel älter ist.
- Im Bereich des Jahres 1000 n. Chr., wurden bereits in Europa “bildhafte” Feierlichkeiten abgehalten, welche eine Vorstufe dieser besonderen Art Karfreitag zu feiern gewesen sein dürften.
- Politische Turbelenzen behindern im weiteren Verlauf die ungestörte Ausübung der Prozession, bis zur Schließung der Ortskirche im Jahr 1797
- Bereits 1802 beginnt die Wiedergeburt des Zeremoniells
- Am 11. Mai 1940, im Rahmen des Westfeldzuges der Wehrmacht, fällt die Ortskirche den Kampfhandlungen zum Opfer, wobei die klassische Jesusfigur und die anderweitigen Ritusartikel verbrennen.
- Die Tradition der Karfreitagsfeier findet jedoch bis Kriegsende, in verkleinerter Form, an anderer Stelle statt.
- Ab 1945 fand wieder die Prozession auf den Straßen Lessines statt.
- 1953 entwirft der Bildhauer Harry Elström die neue Jesusfigur.
radition. Heutzutage wird (im Hinblick auf die moderne Identifikationsfindung) kaum ein Wort häufiger in der politischen Diskussion Deutschlands verwendet, als das simple “Tradition” – meist vermengt mit der “Kultur”. Fleissig wird sich dann darum bemüht, einen halb unverdaulichen Brei aus den genannten Worten, wie auch aus der Religion, zu quirlen, den kaum einer bei Sinnen zu sich nehmen würde.
Es wird diskutiert, gestritten und mit Floskeln um sich geworfen, die in der Regel die Qualität des üblichen Wurfmaterials eines Pavianfelsens besitzen. Warum also dieser ganze Trubel, um Dinge aus der Vergangenheit, die bis vor wenigen Jahren immer mehr dahinschwanden und in Vergessenheit gerieten? Weil die Welt sich weiter dreht, unaufhörlich und genau das Menschen Angst macht. Angst vor der Zukunft, Angst vor ungewissen Eventualitäten. Angst davor, einmal nicht den Weg zu kennen und selbst einen neuen finden zu müssen. Dabei werden die alten Geister gerufen, ohne Rücksicht auf deren wirklichen Nutzen, jedoch immer in Hinblick auf den Grad der persönlichen Annehmlichkeit; da wird die christliche Identität beschworen, doch sollen Fehl- und Totgeburten dann doch bitte auf dem Gottesacker – und nicht davor, an der Mauer – beigesetzt werden.
Huch, nicht bekannt? Auch wenn der Limbus puerorum mittlerweile vom Papst abgeschafft wurde, galt es über die Jahrhunderte hinweg als fester Bestandteil der Lehre, dass ungetaufte Kinder in eine Art Vorhölle (eben jenem Limbus) kommen (bis man mittlerweile wohl gemerkt hat, dass sich die Nummer im allgemeinen Christentum ganz schlecht verkaufen lässt…weswegen man das einfach mal abgeschafft hat, so halb), was eine Beerdigung an der Friedhofsmauer nach sich zog. Direkt am Bürgersteig, wo das Unkraut wächst und die Hunde ihrer Notdurft nachkommen. Das wünscht man sich doch, als traumatisiertes Paar, für das Kind was keine Chance hatte – oder?
Selektive Wahrnehmung des Brockens “Glauben”, den diese christliche Identität, mit all seinen Zwängen, mit sich bringt. Zwänge, derer wir uns (in harten Kämpfen und zum Wohle aller) entledigt haben – Gott sei’s gedankt! Denn einmal ganz ehrlich und mit Hand auf’s Herz: Wer liebt ihn nicht, den Sex vor der Ehe? Die Gleichstellung von Mann und Frau? Die Tatsache, dass man sich scheiden lassen kann, wenn es dann doch mal nicht passt (ohne als Aussetzige*r behandelt zu werden)? Trotz der Verwendung moderner Technik nicht als lebende Straßenbeleuchtung enden zu müssen? Der Humanismus kann so schön sein.
Zwei Stunden Fahrt, vorbei an Brüssel und an den Randbereichen von Charleroi entlang, lagen hinter uns, als wir in einer anderen Welt ankamen; Lessines, eine Gemeinde der Wallonie mit gut 18.500 Einwohnern. Der Ort empfing uns in typischer Manier der Region; Schlagloch reihte sich an Schlagloch und gemeinsam warteten sie in den Straßen nur auf unvorbereitete Fahrer, denen die Gepflogenheiten des wallonischen Straßenbaus ungeläufig waren – eine Ode an jeden Stoßdämpfer, die für volle Auftragsbücher in den Werkstätten Sorge trug.
Es war ein typisches Dorf der Wallonie, welches sich uns in der Zeit der Durchfahrt zum Ortskern zeigte; ein wenig heruntergekommen, ein wenig schmutzig und kein Haus wollte daran schuld sein, ein möglicherweise einheitliches Straßenbild zu geben. Hin und wieder eine verirrte Mülltüte, dann woanders wieder eine verkeilte Jalousie und doch standen auf den Straßen Autos, wie man sie sich kaum noch zu leisten vermag als Angehöriger der Mittelschicht – gepflegt und gehegt, als wären sie ein Teil der Familie. Eine besondere Eigenheit der frankophonen Region, die man irgendwann zu schätzen lernt.
Wir parkten hinter einer der Frittenbuden, zwischen Baustelle und Kanal, wie es bereits viele der anderen Besucher vor uns getan hatten. Wo in diesem Ort die Baustelle anfing und wo die Normalität endete, war nicht ganz so einfach zu ersehen, doch entschädigte der klassische Duft von Kartoffelstäbchen, die in Rinderfett zur Krebserregbarkeit frittiert wurden. Wir hatten die kleine, etwas heruntergekomme Frittierfetthölle beinahe übersehen, bei unserer Suche nach einem Parkplatz, doch entschädigte der Geruch und der flüchtige Blick durch die verkrusteten Fenster des gastronomischen Guerillaangriffs für alles weitere. Während ich im Geiste wieder einmal mich selbst verfluchte, erneut ohne ausreichend Bargeld auf Tour gefahren zu sein, kramten wir unsere Kameras zurecht und vertraten uns ein wenig die Beine, zwischen ungeteerter Straße und Tragesäcken voller Bruchsteinen.
Etwas Sorge bereitete das Wetter, welches uns bereits auf der Hinfahrt mit einer bunten Vielfalt aus Regen, Trocken, Regen, Trocken und ab und an auch mal etwas Niesel unterhalten hatte. Jede App sagte etwas anderes aus, was die Beständigkeit und die herrschenden Verhältnis anbelangte und der Himmel wechselte im Minutentakt die Stufen seiner Bedrohlichkeit. Mit dem Mut zivilisatorisch verweichlichter Männer, strotzten wir der akuten Gefahr des Regens und beeilten uns, um noch zeitig bei der Messe sein zu können. Die Kirche war nicht sonderlich weit entfernt und so stapften wir an leerstehenden Geschäften, überfüllten Glutamattempeln und von Neugier erfüllten Gesichtern vorbei, die uns in einer Art musterten, wie man es sich sonst nur von Sträflingen vorstellen könnte, die einen neuen Gefangenen mit ungesund weiblichen Gesichtsformen erblickt haben. Warum auch immer, aber es schien uns breit und in leuchtender Schrift auf die Stirn geschrieben, dass wir keine Wallonen waren.
Irgendwann verschwand der zerfressenen Asphalt unter unseren Füßen und wesentlich bestandhafteres Kopfsteinpflaster schmiegte sich an die Sohlen, kurz bevor wir, in eine Seitengasse abbiegend, die Kirche erreichten. Aus dem Inneren drang bereits ein Chor, der so kräftig war dass er noch den in Dunkelheit getauchten Vorplatz zu beschallen vermochte und einen Vorgeschmack darauf gab, was uns erwarten sollte. Bereits verkleidete Teilnehmer der Prozession standen bereit und zugleich, eher unbewusst, ein wenig im Durchgang zur Kirche. Mit einigen kurzen “pardon” schafften wir es jedoch, uns recht zeitig in den Vorraum der Kirche durchzuschlagen, von wo aus wir durch Glastüren dem Schauspiel im Inneren schon einmal im Ansatz beiwohnen konnten.
Nach einigen Augenblicken, derer wir voller Respekt nicht wagten in die laufende Messe hereinzuspazieren, um uns einen Sitzplatz zu suchen, wurden wir von einem Dorfbewohner gerade zu dazu genötigt die Messe zu betreten, als er uns mit einem durchdringenden “Entrez-vous!” die Türe aufhielt und uns damit unmissverständlich klar machte, dass wir endlich unsere Hintern hereinschwingen sollten. So leise, wie es eben nur ging, suchte wir uns einige der Stühle aus, die weit genug vom Geschehen entfernt waren um keine Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Ein paar giftige Blicke sollten uns dennoch treffen, als die viel zu lauten Stühle über den steinernen Kirchenboden glitten, um unseren gut genährten Gesäßen entgegenzukommen. Es hatte sich, seit meinem letzten Kirchenbesuch vor unzähligen Jahren, nur wenig an der Gastfreundschaft des üblichen Publikums etwas geändert, welches, von seinen eigenen Problemen besessen, jeden Funken der vermuteten Heiligkeit für sich, ungestört und am liebsten in absoluter Einsamkeit, beanspruchte – in verzweifelter Sehnsucht nach Erlösung, von den alltäglichen Problemchen die uns in der ersten Welt so bedrücken.
Ein kurzer Blick zur Orientierung, den ich nach wenigen Sekunden wagte, offenbarte eine piepsende Armee von kleinen Point&Shoot Kameras, die fleissig damit beschäftigt waren den Körper der Kirche in stimmungstötendes Blitzlicht zu hüllen, zumeist mit der berauschenden Leitzahl von 5. Von dem Spektakel der fotografischen Unvernunft in jeglicher Form unbeeindruckt, vollführte der Chor weiterhin sein hörenswertes Werk und die Geistlichen schien dies eben so wenig zu kümmern. Man war anscheinend daran gewöhnt, dass Touristen hier ihr eigenes Spektakel aufführten: Ein stiller Wettbewerb darin, wer die erste Erblindung des Abends zu verantworten hätte.
Den Geistlichen, die in rotem Licht getränkt vom Altar aus ihr Zeremoniell abhielten, war allgemein das Getrubel in der Kirche keines Blickes wert, waren sie doch eher damit beschäftigt ein wenig Ordnung in ihre eigenen Abläufen einzubringen, die bisweilen nicht ganz so sauber ineinander griffen, wie man es von den Messen aus den Zeiten seiner Kindheit her kannte. So wurde ab und an der Messdiener, der einen zwangsverpflichteten Eindruck erweckte, mit starren Blicken und fast kaum wahrnehmbaren Bewegungen der Köpfe dirigiert, was in mir Mitleid für diesen unliebsamen Posten erweckte. Nach einer guten, halben Stunde dieses Schauspiels, welches durch die hohe Qualität des Chors getragen wurde, begannen plötzlich immer mehr Männer mit Roben und Kapuzen in die Kirche zu strömen und sich zu positionieren, um ihre Vorbereitungen treffen zu können. Es wurden gläserne Laternen aus Messing mit Kerzen bestückt, die aus der Ferne bereits das Gefühl von Schwere vermittelten und es schien so, als wären noch letzte Absprachen getroffen worden.
Während am Fuß des Altars das Ebenbild Jesu am Kreuze der Gemeinde entgegengehalten wurde, so dass dessen Füße geküsst werden konnten von jedem, dem es danach verlangte, begann allmählich die Beleuchtung zu schwinden, bis die Kirche nur noch im drückenden rot des Altarraums beleuchtet wurde.
Im Schutz der Dunkelheit, sammelten sich nun die Robenträger und stülpten ihre Kapuzen über, während zugleich eine Figur, die Jesus Leichnam darstellen sollte, nun in die Mitte des Hauptganges gerückt wurde, wonach sich um sie herum die Träger der Figur sammelten, die wiederum von Laternenträgern in schwarzen Roben begleitet, ja gerade zu bewacht wurden. Während das theologische Handwerk am Altar vielleicht ein wenig hölzern erschien, griff hier jedoch alles Hand in Hand und man konnte Übung und Vorbereitung erahnen, die weit über ein touristisches Schauspiel hinausging. Jeder wusste blind, wo er zu stehen hatte und auch die jungen Mädchen, die in ihren schwarz-weissen Roben zur Marienfigur schlichen, schienen den Ablauf mit der Muttermilch aufgenommen zu haben.
Um von den weltlichen Vorbereitungen dann doch ein wenig abzulenken, auch wenn sie wirklich nahtlos erfolgten, öffneten flinke Hände die Hauptpforte der Kirche und verkeilten die Glastüren, während die Augen und Ohren der Gemeinde auf ein entferntes, sich aber rasch näherndes Getrommel abgelenkt wurden; Gekleidet in den bereits erblickten Roben und Kapuzen, näherten sich vom Vorplatz Trommler und Fackelträger und betraten die Kirche. Ab hier begann die Atmosphäre, die Stimmung eine Form anzunehmen, die man schmecken und berühren konnte. Alles hier verdichtete sich unter den Schlägen der Trommler, die in der Kirche ein vielfaches der zuvor wahrgenommenen Intensität erlangten. Kinder im Schulalter, mit Rasseln bewaffnet, sorgten zusätzlich zur bedrohlichen Stimmung, die sich nun ergab während die Trommler die Mauern der Kirche gegen den Uhrzeigersinn abschritten und dabei ihr Gefolge unmerklich vergrößerten. Die Trommler schlugen immer heftiger zu, so wirkte es und selbst einem der Pressefotografen, der mir zuvor das Blitzlicht direkt ins Gesicht gehalten hatte, schien die überwältigende Stimmung auf den nervösen Auslösefinger geschlagen zu sein, den ich ihm am liebsten zuvor gebrochen, oder in eine seiner eigenen Körperhöhlen gesteckt hätte.
Leider verweilte er nur sehr kurz mit dem Gesichtsausdrucks eines Goldfischs, bevor er wieder in eine besondere Form der Hektik verfiel, welche auf die Sorte Nervosität hindeutete die selten mit Talent oder Übung einherging; ohne Rücksicht auf die Anwesenden, quetschte er sich durch die Menge, feuerte immer wieder eine Salve mit seiner Kamera ab, wobei sein Blitz die Träger merklich irritierte und bemühte sich ansonsten nach allen Kräften, wie es die Kunst der Pressefotografen kleinerer Zeitungen für gewöhnlich ist, negativ in Erscheinung zu treten. Hätte ich ihm meinen Ellenbogen in die Nieren gerammt, man hätte mich mit Gewissheit auch durch das Dorf getragen und ein wenig gefeiert.
Doch war ich für etwas anderes hier und ließ mich, trotz der Störung, mittreiben und einnehmen von dem, was nun diese Kirche erfüllte. Wie der Duft des Weihrauchs, so war auch nun etwas anderes allgegenwärtig, ja gerade zu greifbar. Ich presste meine Kamera fest an mein Gesicht, während ich im Dunkel und bei astronomischer ISO darauf hoffte, mit der manuellen Linse auch nur irgendetwas scharf und unverwackelt hinzubekommen. Die Belichtungszeit überließ ich der Kamera, den Fokus meinen Fingern und den Tremor in meinen Knochen dem Zufall. Irgendetwas sollte dabei schon herumkommen, schoss es mir durch den Kopf – und wenn nicht, so hatte ich zumindest eine Erfahrung mehr in meinem Leben, die mir höchstens ein saftiger Schlaganfall hätte nehmen können. Foto um Foto schoss ich, während ich zugleich ein unbewusster Teil der Prozession wurde und mich, wie auch Jörg und Ulli, im Gleichschritt den Scharen an Gläubigen, Touristen und sich spontan vermehrenden Presseheinis anschloss, die um die Büßer schwirrten, wie die Motten ums Licht (oder die Fliegen um etwas anderes).
Wir folgten den Trommelschlägen, den Rasseln, den Fackeln hinaus in die pechschwarze Nacht, die von keinem einzigen Lichtschein gestört wurde; das ganze Dorf lag in Finsternis, einzig die Fackeln der Robenträger und ein paar billige Wegmarkierungen von Verkehrskadetten durchbrachen das Schwarz. Wie ich später erfahren sollte, stand es wohl unter Strafe zu den Feierlichkeiten Licht anzulassen und in einem mir bisher ungeahnten Grad an Organisation, den man zuweilen etwas in Belgien vermisst, hielten sich alle Bewohner an dieses Verbot. Wir versuchten hinterher zu kommen, tappsten über das Kopfsteinpflaster hinter der Prozession her, die im Gleichschritt durch das Dorf zog und die Leute aus ihren Häusern lockten, wie ich es sonst nur vom Karneval her kannte. Neben uns ein Kamerateam, bewaffnet mit LED Beleuchtungen und einem Mangel an Respekt für dieses Schauspiel – vor uns weitere Pressefotografen. Es wurde an einigen Stellen unüberschaubar und immer öfters hatte man ungewolltes Licht, oder ungewollte Schädel im Bild, doch wir alle wollten mehr sehen von diesem Schauspiel, diesem Kuriosum welches so viele Emotionen und Assoziationen weckte.
Unfreiwillig kamen Vergleiche mit dem Paradebeispiel US-Amerikanischer Idiotie, dem KKK, auf, doch war dies hier weit davon entfernt.
Ich kannte derartiges nicht, wie ich es gerade hie zu sehen bekam, diese Form von religiösem Eifer, oder dessen Darstellung in dieser Art. In gewisser Art und Weise verstörte es und wie sie hier durch die Straßen zogen, ihre Gebete murmelnd, so hätten sie auch, ohne dass es mich verwundert hätte, eine rothaarige Frau mit Vorliebe für Kräuterkunde zur lebenden Fackel verwandeln können. Der Grat war schmal an dieser Stelle.
So wurde mir das ganze hier immer unverständlicher, war ich doch nur ein kleiner Rheinländer, dessen Begeisterung für Religion von einer erschreckend klischeehaften Reihe von Religionslehrern und innen abgetötet wurde. Der jeden Dienstag, zu Grundschulzeiten, mit der Klasse in die Schule marschieren musste, um sich (dies nur als kleine Kostprobe) dort eine Predigt über die Sündhaftigkeit von Jurassic Park anhören zu müssen.
Die letzten Funken, die ich für die katholische Kirche an Sympathie übrig hatte, starben im Kommunionsunterricht, als der Dorfpfarrer, der mich bereits 1985 nicht taufen wollte weil meine Eltern zu eifrig und zu erfolgreich bei meiner Zeugung (als es die Kirche in der Regel vor der Ehe gerne sieht) waren, ausgiebigst versuchte mich zu “mobben” und sich eine Freude daraus machte, mich als Brillenschlange und Raffzahn zu betiteln. Ein über 60 Jahre alter Pfarrer, der einen 9 Jahre alten Jungen mit Brille und einer Zahnfehlstellung vor 8 anderen Kindern hänselte. Die Androhung irdischer Gewalt, die mein Großvater diesem Prachtexemplar an christlicher Nächstenliebe gegenüber äußerte, änderte zwar in überraschend positiver Form die Art und Weise, wie er mit mir damals umging, doch änderte es nichts mehr daran wie mein Verhältnis zum Christentum seit diesen Tagen stand.
Doch lief ich diesem befremdlichen, beängstigenden Schauspiel hinterher, wich Staßensperren und Pollern aus und riskierte es in jeden Hundehaufen dieser Stadt zu treten. Was mich dazu trieb, dieses mir so fremde Unikat an Darbietung in Nordeuropa fotografisch zu erfassen, konnte ich mir selbst nicht ganz schlüssig machen, doch ging es anscheinend uns allen so, wie wir uns gegenseitig antrieben immer bessere Blickwinkel und Szenen einzufangen. Zu stören schien es die Darsteller dieser Attraktion nicht, ganz im Gegenteil sogar, positionierten sie sich ab und an, blickten direkt in die Kamera, oder reckten ihre Fackeln noch ein Stückchen höher, sobald ein Objektiv auf sie gerichtet wurde.
So ging es knappe zwei Stunden, quer durch das stockdunkle Dorf, vorbei an Altenheim und Krankenhaus, immer an begeisterten Bewohnern Lessines entlang; das ganze Dorf stand in seinen Türen, hing in seinen Fenstern und reckte sich die Hälse aus.
Noch Stunden später, bereits wieder in Aachen angekommen, schossen mir Gedanken zu diesem Erlebnis durch den Kopf und irgendwie wollte mein Verstand das ganze nicht so einfach verarbeiten. Sicher, es waren nur verkleidete Wallonen, die hier eine mittlerweile fast reine, touristische Aufführung abhielten, doch steckte hinter solchen Schauspielen einst einmal etwas völlig anderes, etwas Menschen beeindrucken, beängstigen sollte. Wie gut es dann doch nun war, so ging es mir durch den Kopf in einem Moment, dass alle diese Mühen der Prozession heutzutage nur noch ein paar irre Fotografen anlockten – und Touristen mit piepsenden Kameras, welche dieses Kuriosum irgendwie einmal gesehen haben wollten.